Immer mehr Eltern beschäftigen sich mit der Frage, ob eine bilinguale Schule die richtige Wahl für ihr Kind ist. Schließlich wachsen Kinder heute in einer Welt auf, in der Englisch und andere Sprachen selbstverständlich sind – sei es im Studium, im Beruf oder im Alltag. Bilinguale Schulen bereiten Kinder von Anfang an auf diese Realität vor. Sie bieten Unterricht, in dem nicht nur Sprachen gelernt, sondern Sprachen als Werkzeug für das Lernen genutzt werden.
Vielleicht fragst Du Dich: Was bedeutet das eigentlich genau? Ist das nicht zu anspruchsvoll für mein Kind? Und welche Vorteile bringt es wirklich?
Hier bekommst Du einen umfassenden Überblick: von den einzelnen Schulstufen, über die Besonderheiten im Unterricht bis hin zu konkreten Beispielen aus dem Alltag.
Wenn Du Dir einen schnellen Überblick wünschst, schau Dir gern das Video an – hier bekommst Du die Kurzfassung des Artikels.
Was macht eine bilinguale Schule besonders?
Im Kern geht es darum, dass Kinder nicht nur im klassischen Englischunterricht eine Sprache lernen, sondern auch Sachfächer in der Fremdsprache erleben. Statt Vokabelheft und Grammatikübungen nutzen sie meist Englisch (manchmal auch Französisch oder Spanisch) als Werkzeug, um über den Regenwald zu sprechen, ein Experiment durchzuführen oder eine Musikstunde zu gestalten.
Die Fremdsprache wird dadurch ein selbstverständlicher Teil des Schullebens – ganz ähnlich, wie es Kinder beim Aufwachsen in zweisprachigen Familien erleben.
Bilinguale Grundschule – ein früher Einstieg
Gerade im Grundschulalter fällt Kindern das Sprachenlernen besonders leicht. Sie sind neugierig, probieren gerne Neues aus und haben kaum Hemmungen. Deshalb setzen bilinguale Grundschulen genau hier an:
- Fächer wie Sachunterricht, Musik oder Sport werden teilweise auf Englisch unterrichtet.
- Die Lehrkräfte nutzen Gestik, Bilder, Wiederholungen und anschauliche Materialien, damit Kinder den Inhalt verstehen, auch wenn sie anfangs noch nicht alles übersetzen können.
- Grammatik wird nicht in den Vordergrund gestellt. Stattdessen lernen die Kinder Sprache im Tun – ähnlich wie beim Erlernen der Muttersprache.
Klassen 1 und 2 – spielerisches Eintauchen
In den ersten beiden Schuljahren geht es vor allem darum, ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln. Die Kinder begegnen der Fremdsprache in Alltagssituationen, beim Singen, Spielen oder im Sportunterricht. Die Lehrkräfte sprechen konsequent in der Fremdsprache und nutzen Gestik, Bilder, Rituale und Wiederholungen, damit die Kinder den Sinn verstehen, auch wenn sie nicht jedes einzelne Wort kennen. Grammatik oder Vokabeln werden nicht isoliert gelernt, sondern entstehen „nebenbei“ im Tun. Auf diese Weise baut sich ein natürlicher Wortschatz auf, der stark mit positiven Erlebnissen verknüpft ist.
Beispiel aus dem Alltag einer 2. Klasse
Im Sachunterricht steht das Thema „Die fünf Sinne“ auf dem Plan. Die Lehrerin spricht fast ausschließlich Englisch: „Can you close your eyes? What can you smell?“ Die Kinder probieren verschiedene Dosen mit Düften aus, beschreiben ihre Eindrücke mit einfachen Wörtern und lachen, wenn jemand „stinky“ ruft. Niemand hat Angst, Fehler zu machen, denn es geht ums Erleben. So entstehen ganz nebenbei Sprachkenntnisse, die sich fest im Gedächtnis verankern.
Klassen 3 und 4 – erste fachliche Vertiefung
Ab der dritten Klasse verändert sich der Anspruch. Kinder können nun schon kleine Dialoge führen, einfache Geschichten verstehen und erste Fachbegriffe anwenden. In diesen Jahrgangsstufen werden auch komplexere Themen im Sachunterricht oder in Naturwissenschaften auf Englisch behandelt. Es geht nicht mehr nur darum, Wörter zu verstehen, sondern Inhalte in einer Fremdsprache zu begreifen und wiederzugeben. Klassenarbeiten enthalten manchmal kurze Texte oder kleine Aufgaben, bei denen die Kinder auf Englisch antworten sollen. Dabei bleibt der Fachinhalt stets im Vordergrund. Am Ende der vierten Klasse erreichen die meisten Schülerinnen und Schüler mindestens das Niveau A1 nach dem Europäischen Referenzrahmen, viele sind darüber hinaus im Hörverstehen und in der Aussprache deutlich weiter.
Sekundarstufe I – Fachwissen in zwei Sprachen
Ab der 5. Klasse vertieft sich das Konzept. Nun geht es nicht mehr nur darum, spielerisch Sprache aufzunehmen, sondern auch komplexere Inhalte in der Fremdsprache zu verstehen.
- Typische Fächer sind Geschichte, Geografie oder Biologie.
- Kinder lernen Fachbegriffe wie „volcano“, „photosynthesis“ oder „industrial revolution“ und setzen sie in Referaten, Diskussionen oder Gruppenarbeiten ein.
- Lehrkräfte achten darauf, dass die Inhalte klar verständlich bleiben. Deshalb enthalten Arbeitsblätter oft kleine Vokabelhilfen, Bilder oder zweisprachige Erklärungen.
Sekundarstufe II – Spezialisierung und internationale Chancen
In der Oberstufe werden bilinguale Angebote besonders interessant:
- Schülerinnen und Schüler können bilinguale Leistungskurse wählen, etwa Geschichte oder Geografie auf Englisch.
- Viele Schulen ermöglichen es, internationale Zertifikate zu erwerben – z. B. das Cambridge Certificate oder sogar das International Baccalaureate (IB).
- Austauschprogramme, Auslandsaufenthalte und Kooperationen mit Partnerschulen sind oft fester Bestandteil.
Das Ergebnis: Jugendliche verlassen die Schule nicht nur mit einem deutschen Abschluss, sondern häufig auch mit einem international anerkannten Sprachzertifikat, das ihnen Türen zu Universitäten weltweit öffnet.
Leistungsbewertung im bilingualen Unterricht
Wenn ein Sachfach wie Biologie, Geschichte oder Sachunterricht auf Englisch unterrichtet wird, bedeutet das nicht, dass die Kinder weniger lernen oder dass der Stoff vereinfacht wird. Im Gegenteil: Der Lehrplan des jeweiligen Bundeslandes gilt uneingeschränkt. Dein Kind bearbeitet denselben Stoff wie in einer regulären Klasse – nur eben in einer anderen Unterrichtssprache. Das ist für viele Eltern eine wichtige Sicherheit, denn es heißt: Kein Thema fällt weg, kein Lernziel wird gestrichen, und Dein Kind verpasst fachlich nichts.
Forschungsergebnisse aus verschiedenen Schulversuchen zeigen sogar, dass bilinguale Kinder in Mathematik teilweise besser abschneiden als ihre Altersgenossen in der Regelschule. Die Erklärung dafür liegt auf der Hand: Wer regelmäßig zwischen zwei Sprachen wechselt und Sachverhalte in einer Fremdsprache durchdringen muss, trainiert sein Gehirn besonders intensiv. Konzentration, logisches Denken und Problemlösefähigkeiten profitieren davon – und das zeigt sich auch in den Ergebnissen der Kinder.
Doch wie sieht die Leistungsbewertung konkret aus? Zunächst einmal gilt: Bewertet wird das Fach, nicht die Sprache. Wenn Dein Kind im Biologieunterricht eine Klassenarbeit schreibt, dann wird geprüft, ob es die Inhalte verstanden hat: Weiß es, wie die Photosynthese funktioniert? Kann es den Aufbau einer Blüte beschreiben? Sprachliche Fehler spielen in dieser Bewertung nur eine Nebenrolle. Lehrkräfte wissen, dass die Fremdsprache ein zusätzliches Lernfeld ist, und berücksichtigen das entsprechend.
In der Praxis bedeutet das: Klassenarbeiten enthalten oft kleine Hilfen wie zweisprachige Arbeitsaufträge, Vokabellisten oder Abbildungen, damit die Kinder zeigen können, was sie inhaltlich gelernt haben. Grammatikfehler oder ein unvollständiger Satz führen nicht automatisch zu einer schlechteren Note, solange das Verständnis des Themas klar erkennbar ist. In Rückmeldungen unterscheiden viele Schulen sogar ausdrücklich zwischen dem fachlichen Lernerfolg und dem sprachlichen Fortschritt, sodass Eltern genau sehen können, wo ihr Kind steht.
Dieses System sorgt dafür, dass Kinder durch den bilingualen Unterricht keine Nachteile haben, sondern im Gegenteil profitieren: Sie erfüllen alle Lernziele des Lehrplans, erweitern ihr Wissen um eine zusätzliche Sprache und gewinnen Selbstvertrauen, weil ihre fachlichen Leistungen unabhängig von sprachlicher Perfektion anerkannt werden.
Der Englischunterricht an bilingualen Schulen
Auch wenn Kinder in bilingualen Schulen bereits in Sachfächern wie Sachunterricht, Biologie oder Geschichte mit der Fremdsprache in Berührung kommen, bleibt der Englischunterricht ein eigenständiges Fach. Er erfüllt den regulären Lehrplan des jeweiligen Bundeslandes und wird systematisch aufgebaut. Das bedeutet: Dein Kind verpasst nichts von dem, was auch in einer normalen Schule gelernt wird – Grammatik, Wortschatzarbeit, Rechtschreibung und Textproduktion gehören ganz selbstverständlich dazu.
Während der Sachfachunterricht die Fremdsprache eher „nebenbei“ mitliefert, ist der Englischunterricht der Ort, an dem Strukturen bewusst erklärt, Regeln eingeübt und sprachliche Grundlagen verankert werden. Kinder lernen dort Schritt für Schritt, wie man Zeitformen richtig bildet, wie Texte aufgebaut sind oder wie man ein Hörverstehen bewältigt. Sie trainieren, kurze Dialoge zu führen, kleine Geschichten zu schreiben oder fremdsprachige Texte zu lesen und zu verstehen.
Das Besondere an bilingualen Schulen ist die gegenseitige Verstärkung von Fach- und Sprachunterricht. Alles, was Kinder im Englischunterricht üben, können sie im Sachfachunterricht sofort anwenden – und umgekehrt erleben sie, wie nützlich die Sprache im Alltag des Lernens ist. Wenn Dein Kind im Englischunterricht die Vergangenheitformen lernt, wird es sie wenig später im Geschichtsunterricht anwenden, wenn es die „Industrial Revolution“ beschreiben soll. Diese Verbindung sorgt dafür, dass Sprache lebendig bleibt.
Ein weiterer Vorteil: Kinder an bilingualen Schulen sind oft motivierter im Englischunterricht, weil sie den praktischen Nutzen direkt spüren. Statt sich zu fragen: „Wofür brauche ich das?“, erleben sie, wie Englisch im Fachunterricht ein echtes Werkzeug ist. Dadurch entsteht ein Lernkreislauf: Der Englischunterricht gibt Sicherheit in der Sprache, der Fachunterricht bietet echte Anwendungssituationen – beides zusammen fördert einen schnellen und nachhaltigen Fortschritt.
Für Dich als Mutter bedeutet das: Dein Kind hat am Ende seiner Schulzeit nicht nur solide Sprachkenntnisse nach Lehrplan, sondern zusätzlich eine Sprachpraxis, die weit über das hinausgeht, was in Regelschulen erreicht werden kann.
Vorteile für Dein Kind
Die Forschung zeigt sehr klar, dass bilinguale Schulen Kindern enorme Vorteile bieten – und dass dabei keine Nachteile in den Kernfächern entstehen:
- Sehr gute Sprachkompetenz schon in jungen Jahren.
- Keine Einbußen in Deutsch oder Mathematik – oft sogar bessere Ergebnisse.
- Stärkung der Konzentration und Problemlösefähigkeiten, da das Gehirn trainiert wird, flexibel zwischen zwei Sprachen zu wechseln.
- Interkulturelle Offenheit, weil Kinder Unterschiede zwischen Sprachen und Kulturen bewusst wahrnehmen.
- Selbstbewusstsein und Motivation, da sie früh erleben: „Ich kann mich in einer Fremdsprache verständigen!“
Herausforderungen, die Du bedenken solltest
So viele Vorteile der bilinguale Unterricht auch bietet, es gibt dennoch einige Punkte, die Du als Mutter im Blick haben solltest. Nicht in jeder Region gibt es eine große Auswahl an bilingualen Schulen, sodass die Entscheidung manchmal auch von den örtlichen Möglichkeiten abhängt. Außerdem steht und fällt die Qualität des Angebots mit den Lehrkräften: Bilingualer Unterricht erfordert Lehrerinnen und Lehrer, die sowohl fachlich als auch sprachlich hervorragend ausgebildet sind. Das ist nicht an allen Schulen gleichermaßen selbstverständlich. Und schließlich sollte Dein Kind die Bereitschaft mitbringen, sich auf die Fremdsprache einzulassen. Gerade am Anfang kann es anstrengend sein, wenn Unterrichtsinhalte nicht sofort verstanden werden. Hier kannst Du viel bewirken, indem Du Dein Kind zuhause spielerisch unterstützt – etwa mit englischen Hörspielen, Filmen oder Kinderbüchern, die den Spaß an der Sprache erhalten und fördern.
Fazit
Bilinguale Schulen sind kein Trend, sondern ein bewährtes Modell. Sie bieten Kindern einen natürlichen Zugang zu Fremdsprachen, fördern ihre kognitive Entwicklung und öffnen internationale Türen.
Wenn Du Dir für Dein Kind eine Schule wünschst, die über den Tellerrand hinausblickt und es optimal auf eine globalisierte Zukunft vorbereitet, ist eine bilinguale Schule eine hervorragende Wahl.

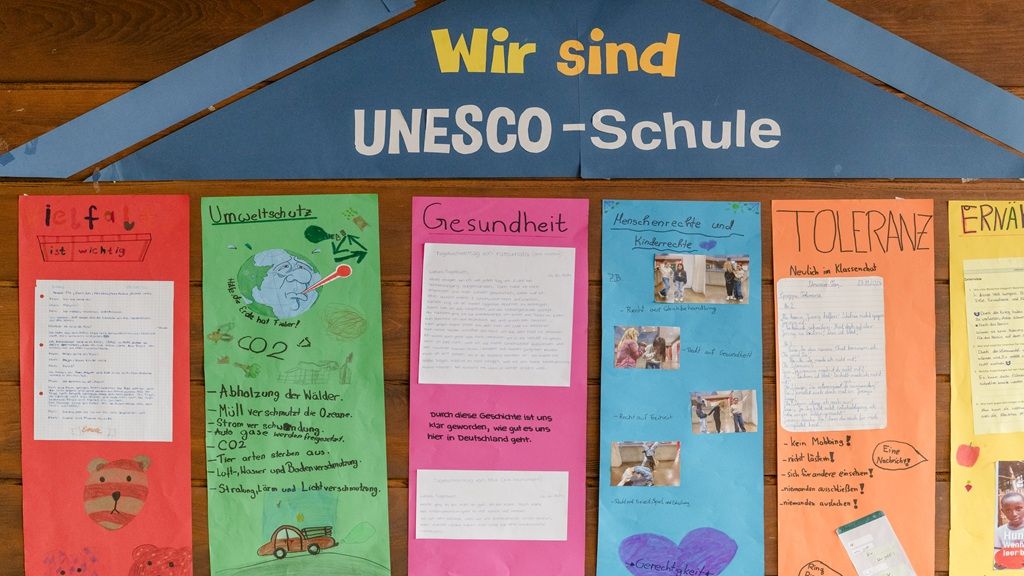
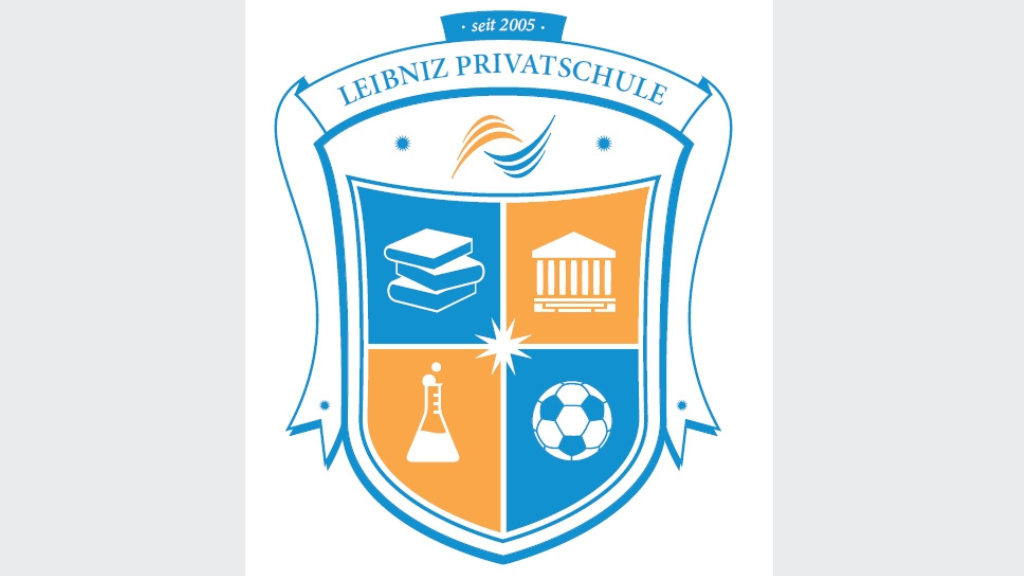

Schreibe einen Kommentar